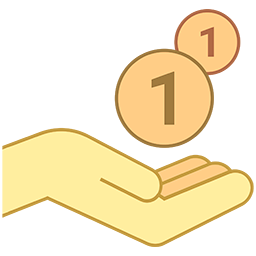Unterstützen Sie den Autor!
Das transkaukasische Dilemma. Wie Russland Armenien und Aserbaidschan verlor

Die jüngste plötzliche und gleichzeitige Verschärfung der russisch-aserbaidschanischen und russisch-armenischen Beziehungen sagt viel über die gesamte Außenpolitik des Kremls aus.

Die aktuelle Eskalation der Spannungen zwischen Moskau und Baku begann mit einem im Grunde genommen routinemäßigen Ereignis in Russland – einem weiteren Übergriff der russischen Polizei gegen diejenigen, die im Alltag in Russland als „Nicht-Russen« bezeichnet werden und auf staatlicher Ebene als „Migranten«. Der Vorfall ereignete sich in Jekaterinburg. Diesmal gingen die tapferen Wächter der russischen Ordnung etwas zu weit. Statt sich, wie es inzwischen Tradition ist, mit dem Abschneiden der Ohren der Festgenommenen zu begnügen, schlugen sie zwei von ihnen – den 60-jährigen Huseyn Safarov und seinen 55-jährigen Bruder Ziyaddin Safarov – zu Tode.
Wie so oft in solchen Fällen wurde erklärt, die Festgenommenen seien an Herzversagen gestorben. Doch Aserbaidschan ist heute nicht mehr das Land, dessen Bürger man sich solche Vorfälle straffrei erlauben kann.
Die getöteten Aserbaidschaner wurden in ihre Heimat zurückgeschickt, wo eine pathologische Untersuchung ergab, dass sie an den Folgen einer grausamen Misshandlung gestorben sind.
Die Reaktion Aliyevs auf die Ereignisse in Jekaterinburg war beispiellos hart. Aserbaidschanische Sicherheitskräfte nahmen im Büro des russischen Sprachrohrs in Baku – „Sputnik Aserbaidschan« – sieben Personen fest, darunter den Chefredakteur Igor Kartavych und den Chefredakteur Jewgeni Belousow, die der Zugehörigkeit zum FSB beschuldigt werden. Offiziell werden sie jedoch wegen Betrugs, illegaler Geschäftstätigkeit und Geldwäsche verfolgt. Aserbaidschan hat zudem alle gemeinsamen russisch-aserbaidschanischen Kultur- und parlamentarischen Veranstaltungen abgesagt.
Das Bild vervollständigten Aufnahmen der Festnahme von zehn Russen in Baku, die später des Drogenhandels und der Cyberkriminalität beschuldigt wurden. Aserbaidschanische Sicherheitskräfte zwangen sie, im Gänsemarsch in die Hocke zu gehen, legten sie mit dem Gesicht auf den Boden und zwangen sie, mit hinter dem Rücken dramatisch verdrehten Armen in Gefangenentransporter zu steigen. Im Grunde war diese Schaukampagne ein Spiegelbild des Polizeiwillkürs, der in Russland gegenüber Migranten während der gesamten Regierungszeit Putins praktiziert wird.
Eine solche Demütigung hat das imperiale Russland wohl seit 200 Jahren nicht erlebt, seit der Zerstörung der russischen Botschaft im Iran und der Ermordung des russischen Botschafters Alexander Gribojedow im Jahr 1829.
Z-Blogger gerieten darüber in regelrechte Hysterie und erfanden Vergeltungsmaßnahmen Moskaus. Am weitesten ging dabei der Fernsehpropagandist Wladimir Solowjow, der auf einen möglichen Krieg Russlands gegen Aserbaidschan anspielte.
Das russische Außenministerium beklagte sich lediglich über den Abbau der bilateralen Beziehungen, und Putins Pressesprecher Peskow versprach, „wir werden die legitimen Interessen unserer Bürger auf diplomatischem Wege verteidigen«. Mit anderen Worten: Einen Krieg, erst recht jetzt, wird es nicht geben.
Hinter Aserbaidschan mit seiner recht ernstzunehmenden und modernen Armee steht die türkische Armee wie eine unüberwindbare Mauer. Was die türkische Armee vermag, zeigte sich bereits im Februar-März 2020 in Idlib, Syrien, wo eine große russische Gruppierung eine vernichtende Niederlage durch die Streitkräfte der Türkei erlitt. Bei den fünftägigen Kämpfen wurden allein auf russischer Seite und bei deren Verbündeten aus der Armee des syrischen Diktators Baschar al-Assad etwa 3.500 Tote gezählt.
Im September-November desselben Jahres 2020 wurde im Kampf um Bergkarabach der offizielle Verbündete Russlands – Armenien – von der aserbaidschanischen Armee, die von türkischen Ausbildern gut vorbereitet war, vernichtend geschlagen. Moskau rührte sich damals nicht, um seinem Verbündeten zu helfen. Hauptgrund für diese Passivität Russlands war die offene Warnung des türkischen Präsidenten Recep Erdoğan, dass die türkische Armee und ihre Luftwaffe eingreifen würden, falls eine ausländische Macht versuchen sollte, in den Konflikt einzugreifen – und zur Verstärkung platzierte er sechs F-16-Kampfjets auf einem aserbaidschanischen Flugplatz.
Putin griff nicht ein. Damals war es ihm nicht möglich, in einen schweren Krieg mit dem mächtigen Bündnis Ankara-Baku einzutreten. Wie heute klar ist, befand sich die Vorbereitung des Angriffs auf die Ukraine damals in der Endphase.
Heute, im Sumpf des Ukraine-Kriegs, kann sich Putin erst recht keinen Angriff auf Aserbaidschan leisten, hinter dem die Türkei steht. Stattdessen kann er dort zuschlagen, wo man es nicht erwartet. Wenn er jetzt nicht offen Aserbaidschan angreifen kann, warum sollte er dann nicht Armenien treffen, das ebenfalls völlig außer Kontrolle geraten ist?
Und tatsächlich, vor dem Hintergrund der beispiellosen Verschärfung der Beziehungen zu Aserbaidschan und Armenien verlegt Moskau laut ukrainischem GUR Truppen auf das Gebiet Letzterem. Vermutlich zur Basis in Gyumri. Doch das ist eine aussichtslose Angelegenheit. Die Basis ist klein, zu besten Zeiten waren dort etwa 2000 Soldaten und Offiziere stationiert. Da in den letzten drei Jahren russische Soldaten, die dort dienten, aktiv in die Ukraine geschickt wurden, kann man vermuten, dass dies nur der Versuch ist, die Anzahl der russischen Militärbasis auf das Vorkriegsniveau zu bringen. Was können diese 2000 russischen Soldaten jetzt dort bewirken? Eriwan, eine Millionenstadt, stürmen? Lächerlich. Von einem Krieg mit Aserbaidschan ganz zu schweigen.
Ohne jegliche Druckmittel gegenüber Aserbaidschan hat der Kreml versucht, Armenien anzugehen. Die Taktik besteht darin, es nicht als Vorposten im Kaukasus zu verlieren. Dafür werden hier mit Moskauer Geld verschiedene „Bewegungen« und „Proteste« finanziert, die darauf abzielen, in Eriwan eine Russland-freundliche Regierung an die Macht zu bringen.
Gleichzeitig hat das armenische Außenministerium vor kurzem überraschend seine Bereitschaft erklärt, der pro-russischen Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beizutreten. Vor dem Hintergrund der katastrophalen Verschlechterung der armenisch-russischen Beziehungen, die wir in letzter Zeit beobachten, wirkt dieser Schritt etwas widersprüchlich. Nur wenige Tage zuvor hatte Armenien erneut die Teilnahme am Gipfel des pro-kremlischen Militär- und Politblocks – der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) – abgelehnt. Und plötzlich die Bereitschaft, der SCO beizutreten. Was soll das bedeuten?
In Wirklichkeit bedeutet es nichts. Eriwan ändert seinen Kurs nicht, Illusionen sollten hier keine bestehen. Der Hauptsitz der SCO und ihr Sekretariat befinden sich nicht in Moskau, sondern in Peking. Und das sagt viel aus. Bemerkenswert ist, dass auch die Ankündigung Eriwans, nicht am OVKS-Gipfel teilzunehmen, vom armenischen Außenminister nicht zufällig in China während seines jüngsten Besuchs dort gemacht wurde.
Armenien wechselt gerade einfach „das Dach«. Und was bleibt ihm auch anderes übrig? Im Bergkarabach-Konflikt hat Russland es verraten, Amerika unter Trump war absolut unberechenbar. Von den Europäern wird das kleine Land im Kaukasus keine schnelle militärische Hilfe erwarten, vor allem angesichts des Krieges in der Ukraine.
Der französische Präsident Emmanuel Macron macht regelmäßig laute Erklärungen zur Unterstützung Armeniens, doch das sind mehr politische Lippenbekenntnisse, während Armenien jetzt ganz konkrete Hilfe und Garantien braucht.
Da von den oben genannten Staaten und Organisationen, die Eriwan verbal unterstützen, keine reale Hilfe kommt und das Land im Stich lassen, gibt Pekings Garantien der armenischen Führung Zuversicht.
Gerade erst hat die Regierung von Nikol Paschinjan einen weiteren Putschversuch im Land niedergeschlagen. Festgenommen wurden Politiker mit offener pro-moskauischer Orientierung: die Erzbischöfe der Armenischen Apostolischen Kirche Mikael Adschapahjan und Bagrat Galstanjan sowie der russische Oligarch Samwel Karapetjan, der einen Großteil der armenischen Energiebranche kontrolliert.
Unterdessen erklärte am 6. Juli der Sonderbeauftragte des aserbaidschanischen Präsidenten Elchin Amirbekov, dass Baku und Eriwan endgültig den Text eines Friedensvertrags vereinbart hätten. Probleme zwischen den beiden Ländern bleiben zwar bestehen, doch die Unterzeichnung eines Friedensvertrags könnte ein Ereignis von großer Bedeutung für die gesamte Region werden.
Armenien und Aserbaidschan können einen endgültigen Schlussstrich unter ihre gegenseitigen Ansprüche ziehen und eine historische Annäherung zueinander beginnen – und nicht nach Moskau.
Im Transkaukasus bleibt Putin noch Georgien mit seiner pro-russischen Führung, doch das bringt kaum noch etwas. Erstens erinnert diese Führung ihn immer wieder daran, dass Russland 20 % des georgischen Territoriums besetzt hält. Zweitens würde er, sollte er Truppen nach Tiflis entsenden, Georgien endgültig verlieren.
Armenien war ein geeignetes Ziel für die Ausweitung seiner Expansion nach Süden, doch dank seiner „klugen« Politik hat sich die Lage verkompliziert – nah am Ellenbogen, aber nicht zu beißen. Das könnte Xi Jinping missfallen.
Mit anderen Worten: Im Transkaukasus steckt Russland in einer Sackgasse. Und diese Sackgasse ist ein gutes Beispiel für die gesamte Außenpolitik des Kremls.
Auf dem Hauptfoto: In Baku festgenommene russische Staatsbürger, die des Drogenhandels verdächtigt werden, werden am 1. Juli 2025 vor Gericht gebracht. Foto: Report via Telegram