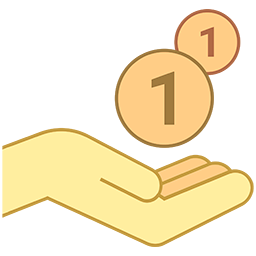Unterstützen Sie den Autor!
Auf Europa zu hoffen – man hofft hundert Jahre vergeblich. Wie die EU ihren Platz in der neuen Welt sucht

Es ist offensichtlich, dass die wichtigste strategische Ausrichtung der EU (in Zusammenarbeit mit Großbritannien) heute vor allem darauf abzielen muss, Autonomie im Bereich der Sicherheit zu erlangen. Das bedeutet sowohl die Waffenproduktion als auch die Ausbildung kampffähiger Armeen und die Schaffung neuer Führungszentren, sei es im Rahmen der NATO oder parallel dazu – gleichzeitig aber auch die Aufrechterhaltung politischer und wirtschaftlicher Stabilität in Europa. All dies stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, da die europäischen Bürger ein friedliches Leben mit zahlreichen sozialen Garantien fortsetzen und nicht auf ihre gewohnte Lebensweise verzichten möchten.

Zu den wichtigsten politischen Ereignissen des letzten Monats gehören zwei Gipfeltreffen, der G7- und der NATO-Gipfel, sowie der schnelle und effektive Angriff Israels auf das iranische Atomprogramm, dem sich rechtzeitig die USA anschlossen, um einen entscheidenden Schlag zu führen. Über das Ausmaß des Schadens wird diskutiert, einige Experten gehen davon aus, dass der Iran in der Lage sein wird, seine Arbeiten an seinem Atomprojekt bald wieder aufzunehmen. Dennoch hinterließ die von Israel und den USA demonstrierte militärische Macht einen starken Eindruck.
Vor diesem Hintergrund wirkten die europäischen Führungspersönlichkeiten wenig überzeugend. Der G7-Gipfel in Kanada verlief nervös und chaotisch, da Donald Trump ihn vorzeitig verließ, um sich wichtigeren Angelegenheiten zu widmen. Um ein ähnliches Szenario beim NATO-Gipfel in Den Haag zu vermeiden, brachte NATO-Generalsekretär Mark Rutte mehrere lobende Worte für den amerikanischen Präsidenten vor, pries dessen Entschlossenheit und Weisheit. Vielleicht trugen diese Bemühungen Früchte und beeinflussten Trumps Wohlwollen während seines Aufenthalts in Den Haag, doch die europäische Presse übte heftige Kritik an ihren politischen Führern, die sich auf zweifelhafte Nebenrollen bei der Hauptshow des Stars aus Washington einließen.
Wäre es nur um protokollarische Missgeschicke und unglückliche Formulierungen gegangen, hätten diese Missverständnisse keine Beachtung verdient. Schlimmer ist Folgendes:
Es konnte den Anschein erwecken, dass sich die Europäer erneut in ihre inneren Zwistigkeiten verstrickten – und die Anzeichen unterschiedlicher Positionen mehr Besorgnis erregten als einzelne merkwürdige Äußerungen.
So etwa rief Emmanuel Macron ständig zu einem Waffenstillstand und Feuerpause im Nahen Osten auf und verband den plötzlichen Abgang des amerikanischen Präsidenten vom G7-Gipfel mit der Vorbereitung von Verhandlungen – wofür er von Donald Trump spöttisch als Verwirrter bezeichnet wurde, der „immer falsch liegt«. Gleichzeitig begrüßte der deutsche Kanzler Friedrich Merz hingegen die israelischen Schläge gegen den Iran und bezeichnete sie als „dreckige Arbeit«, die „für uns alle erledigt wurde«. Beim NATO-Gipfel gratulierten sich alle Teilnehmer gegenseitig zur Absicht, die Verteidigungsausgaben auf 5 % zu erhöhen (wobei 1,5 % davon für Infrastruktur vorgesehen sind), doch der spanische Premierminister Pedro Sánchez hielt eine solche Verschwendung für unmöglich und zog damit sofort Trumps Zorn und Drohungen auf sich.
All diese Umstände ließen erneut von einem neuen „Niedergang Europas« sprechen, das sein wirtschaftliches, menschliches und historisches Potenzial nicht in politische Macht umsetzen kann – und folglich dazu verdammt ist, gegen zielstrebigere und entschlossenere Akteure in der sich wandelnden Welt zu verlieren. Diese Sichtweise ist bekannt, berücksichtigt aber möglicherweise nicht einige wichtige Faktoren.
Handelskrieg
Der Eindruck von den G7- und NATO-Gipfeln fiel tatsächlich nicht zugunsten der Europäer aus. Der erste kann als Misserfolg, wenn nicht sogar als Fiasko gewertet werden, da Trump offen Desinteresse an der Agenda zeigte und seine gewohnte Missachtung der Verbündeten durch einen vorzeitigen Abgang ausdrückte. Aus diesem Grund bemühte sich NATO-Generalsekretär Mark Rutte, ein ähnliches Szenario in Den Haag zu verhindern.

Das schwere Wissen um die Eigenheiten des amtierenden amerikanischen Präsidenten ließ von ihm alle möglichen Erklärungen erwarten, je nach Stimmung, einschließlich der Ablehnung von Artikel 5 der Charta und einer Neubewertung der Rolle der USA im Bündnis. Gerade jetzt, wo der Krieg in der Ukraine andauert, in Europa Risiken einer militärischen Eskalation mit Russland bestehen und europäische Länder mit Aufrüstung und Stärkung ihrer Armeen beginnen, wäre ein Skandal bei der NATO äußerst unerwünscht. Nicht nur wegen des Imageschadens oder der unerfreulichen Ermutigung im Kreml, sondern vor allem wegen der Notwendigkeit, das Bündnis unterwegs und dringend umzugestalten. Zu viel in der NATO hängt auf technischer und organisatorischer Ebene von den Amerikanern ab.
Andererseits war es für die Europäer sehr wichtig, Trumps Bewusstsein für die Problematik des Krieges in der Ukraine zurückzugewinnen, was durch ein persönliches Treffen der Präsidenten erreicht werden konnte. In Kanada, beim G7-Gipfel, fand dieses nicht statt; in Den Haag gelang es, die Anreise Selenskyjs zu organisieren und einen kurzen Dialog mit Trump, was als relativer taktischer Erfolg gewertet werden kann.

Wie dem auch sei, im abschließenden Kommuniqué ist die Verpflichtung der Parteien zu Artikel 5 der NATO-Charta(8) enthalten, und das Verhalten des amerikanischen Präsidenten, abgesehen von Angriffen gegen das widerspenstige Spanien, schien durchaus friedlich. Doch wenige Tage später wurde in Washington die Aussetzung der Militärhilfe für die Ukraine bekannt gegeben, was erneut die Vergeblichkeit der Bemühungen bestätigte, mit der aktuellen US-Administration feste Vereinbarungen zu treffen.
Abseits der beiden Gipfel gab es jedoch noch ein Thema, das weitaus bedeutender war als die protokollarischen Lächeln der politischen Führer. Es handelt sich um Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen zwischen der EU und den USA.
Bekanntlich ist Präsident Trump ein aktiver Befürworter hoher Zölle auf in die USA eingeführte Waren. Er betrachtet das Handelsbilanzdefizit als einen Raubüberfall am helllichten Tag und macht dabei keinen Unterschied zwischen Verbündeten und weniger freundlichen Ländern. Es überrascht daher nicht, dass er innerhalb weniger Monate Zölle auf Waren aus der EU ankündigte, einige davon wieder aufhob und dann einen Großteil bis zum 9. Juli aussetzte, wenn der Abschluss der Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen erwartet wird. Dieser Termin rückt näher, doch die Gegensätze zwischen den Parteien sind bekanntlich sehr groß.
Die Situation wird dadurch erschwert, dass nur die EU und China in der heutigen Welt über vergleichbare Wirtschaftskraft wie die USA verfügen und bei Wunsch eine Eskalation der Zölle mit Washington eingehen könnten – sich aber vorerst für Verhandlungen mit Trump entscheiden, um die schlimmsten Szenarien zu vermeiden.
Offensichtlich will niemand in der EU einen Handelskrieg mit den USA, aber Brüssel ist sich sowohl der Vorteile seiner Position bewusst, darunter ein einzigartiger Markt mit 450 Millionen zahlungskräftigen Verbrauchern, als auch seiner Schwächen.
Das Problem der Verhandlungsposition der EU besteht darin, dass das Interesse der verschiedenen europäischen Länder am amerikanischen Markt nicht übereinstimmt.
So exportiert Deutschland Maschinen in die USA, während Frankreich Cognac und Champagner liefert, und wenn Washington hohe Zölle auf die eine Warengruppe erhebt, die andere aber bevorzugt behandelt, könnte dies die europäischen Reihen spalten. Die EU ist wirtschaftlich nur dank ihrer Einheit stark, was in den europäischen Hauptstädten gut verstanden wird. Deshalb sollte man den Bildern von den Gipfeln nicht zu viel Bedeutung beimessen, sie bedeuten weder Zustimmung der Europäer zur amerikanischen Dominanz noch Verzicht auf den Schutz eigener Interessen. Es handelt sich lediglich um eine taktische Manöver, dessen Angemessenheit natürlich diskutiert werden kann.
Iran und Ukraine
Eine gewisse Passivität Europas in Nahostangelegenheiten sowie die Uneinigkeit der europäischen Führung hinsichtlich der israelischen Aktionen können als eine Art „Rückzug aus der Geschichte« interpretiert werden, als Aufgabe früherer Positionen zugunsten neuer, jüngerer und durchsetzungsfähigerer Anspruchsteller. Andererseits ist auch eine pragmatische Sicht möglich: Europa erkennt an, dass dies „nicht ihr Krieg« ist. Alle sind sich einig, dass der Iran keinen Anspruch auf Atomwaffen erheben darf, sich an den Vertrag zur Nichtverbreitung halten und mit der IAEO kooperieren muss. Darüber hinaus kann jemand wie Macron zu Verhandlungen aufrufen und vor den Folgen einer Eskalation warnen, während jemand wie Merz Israel für die gut gemachte Arbeit gratuliert – das ist lediglich eine lokale Position einzelner Länder in ihren bilateralen Beziehungen zu Israel, der arabischen Welt oder dem Iran.
Ganz anders sieht es bei der Ukraine aus. Viele Umstände bestimmen eine andere Haltung zu diesem Krieg, der in Europa, in unmittelbarer Nähe der EU-Grenzen, geführt wird. Dabei ist Russland der Aggressor, der in Osteuropa historisch als direkte Bedrohung wahrgenommen wird, und dafür gibt es gewichtige Gründe. Aus dem Gesamtbudget der EU(10) sowie aus den Einzelbudgets der EU-Länder wurden bereits Hunderte Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine und zur Hilfe für Flüchtlinge bereitgestellt. Die USA bemühen sich, sich von den Problemen des Alten Kontinents generell und der Unterstützung Kiews im Besonderen zu distanzieren und diese Lasten den Europäern aufzubürden, was in der Sache keine Einwände hervorruft, aber eine zügige Umstellung der europäischen Wirtschaft auf eine militärischere Ausrichtung erzwingt.
Eine Niederlage der Ukraine würde für Europa nicht nur das Erscheinen einer gut bewaffneten Armee an seinen Grenzen bedeuten, die frische Kampferfahrung und den Geschmack des Sieges gewonnen hat, sondern auch die dringende Notwendigkeit, ein neues Sicherheitssystem zu errichten, das sowohl die russische Bedrohung als auch die Unzuverlässigkeit der amerikanischen Verbündeten berücksichtigt.
Unter diesen Umständen ist es wenig verwunderlich, dass die Europäer kein großes Interesse daran hatten, sich in den Konflikt um den Iran einzumischen, sondern ihre Anstrengungen auf das komplexe Geflecht der Verhandlungen mit den USA und die Fortsetzung der Unterstützung der Ukraine bei unklarer amerikanischer Haltung konzentrieren wollten.
Besonders erwähnenswert ist ein unerwartetes Telefonat zwischen den Präsidenten Macron und Putin, die fast drei Jahre lang nicht miteinander gesprochen hatten. Laut spärlichen offiziellen Berichten diskutierten die Seiten über Iran und Ukraine, wiederholten aber nur ihre bekannten bisherigen Positionen. In diesem Zusammenhang ist wenig verständlich, warum das Gespräch ganze zwei Stunden dauerte – und warum der russische Präsident, der so oft in herablassendem Ton über die Europäer sprach und ihnen im Vergleich zu den USA keine Subjektivität zugestand, überhaupt abnahm.

In Wirklichkeit hängt vieles von der Position Europas ab, ohne ihre Meinung wird Trump kein Abkommen mit Putin über die Ukraine schließen, was die russische Seite gut versteht. Mit Macron oder Merz wird man trotzdem sprechen müssen; möglicherweise gibt es jetzt neue Voraussetzungen dafür.
Strategie und Taktik
Es ist offensichtlich, dass die wichtigste strategische Ausrichtung der EU (in Zusammenarbeit mit Großbritannien) heute vor allem darauf abzielen muss, Autonomie im Bereich der Sicherheit zu erlangen. Das bedeutet sowohl die Waffenproduktion als auch die Ausbildung kampffähiger Armeen und die Schaffung neuer Führungszentren, sei es im Rahmen der NATO oder parallel dazu – gleichzeitig aber auch die Aufrechterhaltung politischer und wirtschaftlicher Stabilität in Europa. All dies stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, da die europäischen Bürger ein friedliches Leben mit zahlreichen sozialen Garantien fortsetzen und nicht auf ihre gewohnte Lebensweise verzichten möchten.
Man kann vermuten, dass die Europäer als taktischen Ansatz die Linie gewählt haben, die Widersprüche mit den USA ständig zu mildern, um Zeit zu gewinnen.
Im Rahmen dieser Linie muss man Zugeständnisse und Imageverluste hinnehmen, aber möglicherweise wird die Geschichte die Richtigkeit dieses Ansatzes bestätigen. Zumal die Position Europas als wohl letzte Hüterin der Werte des Völkerrechts nicht so veraltet ist, wie es Anhänger von Gewaltmethoden glauben mögen. In der heutigen Welt teilen nicht alle die Methoden von Trump oder Putin. Wenn man von den Ländern des globalen Südens spricht, so greift beispielsweise in Südamerika niemand einander an, und das Hauptproblem ist die Entwicklung. Gleiches gilt für viele Länder Afrikas oder Südostasiens – jedes hat natürlich seine eigenen Sorgen, aber der EU-Markt ist für alle attraktiv, ebenso wie das Spiel nach Regeln beim Schutz nationaler Interessen. Langfristig könnten der ruhige Ton der Europäer und ihre Treue zu den Prinzipien des Völkerrechts (sofern diese Eigenschaften erhalten bleiben) breite Anerkennung finden.

Dennoch beunruhigen all diese Tänze der europäischen Führer um Trump, egal wie ihre taktischen Begründungen aussehen mögen, aus zwei Gründen. Erstens muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Reihe geschickter Manöver einer festen und prinzipiellen Haltung weichen – sonst wird die Gewohnheit zum ständigen Lavieren nur das Intrigenspinnen festigen, aber nicht zur Erreichung strategischer Ziele führen. Zweitens darf man die europäischen Wähler nicht vergessen, die sich nicht in die Feinheiten der Kommunikation mit dem amerikanischen Präsidenten vertiefen wollen, aber auf die Handlungsfähigkeit ihrer eigenen Politiker hoffen. Wenn es um das Wachstum populistischer Kräfte in Europa geht, gilt als eine der Hauptursachen dafür die Unfähigkeit der europäischen politischen Klasse, schwierige Entscheidungen zu treffen, ihre Neigung zu Kompromissen und Schwankungen sowie die Faszination für taktische Züge zulasten strategischer Standhaftigkeit. Enttäuschte Wähler könnten in diesem Fall neue Kräfte zur Führung aufrufen, die wiederum die aktuellen europäischen Sicherheitsprogramme überdenken werden. In diesem Fall wird das kunstvolle Lob von Mark Rutte an Donald Trump in die Geschichte als Beispiel für nutzlose und ruhmlose Bemühungen eingehen, die besser verwendet werden könnten.
Auf dem Hauptfoto: Donald Trump im Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte beim Gipfel in Den Haag, 25. Juni 2025. Quelle: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Bart Maat / CC BY-SA 4.0