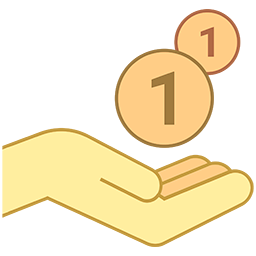Unterstützen Sie den Autor!
Unfreiheit ohne Gleichheit und irgendeine Brüderlichkeit. Warum Frankreich vor 85 Jahren beschloss, mit Hitler zu kooperieren?

In Paris ging man einen faustischen Pakt mit dem Teufel ein, in der Hoffnung, wenigstens etwas vom eigenen Land zu bewahren. Doch die nationalsozialistische „Friedenspolitik« verfolgte genau das Ziel, die Besiegten vollständig zu verschlingen.

Vom Engagement Frankreichs im Zweiten Weltkrieg bleibt ein merkwürdiger Nachgeschmack, der bis heute immer wieder spürbar ist. Juristisch ist das Land eine der Siegermächte, die gegen den Nationalsozialismus kämpfte und im Mai 1945 die Kapitulation der Hitler-Truppen entgegennahm. Dennoch dient die Kampffähigkeit der französischen Armee der 1940er Jahre immer wieder als Anlass für Spott bei Ausländern, in pseudo-historischen Apokryphen erscheinen gerade die Franzosen als „unechte« Sieger, und die lokalen Politiker sind selbst im 21. Jahrhundert gezwungen, sich für die Beteiligung ihres Volkes am Holocaust zu entschuldigen.
All dies ist ein langanhaltendes Echo des kurzlebigen Vichy-Regimes, einer der unangenehmsten Seiten der nationalen Geschichte. Einerseits darf es nicht die Heldentaten der vielen tausend Franzosen überschattet, die tapfer gegen das Dritte Reich kämpften. Ganz gleich, ob in Partisanenverbänden zu Hause, in den afrikanischen Kolonien oder über Osteuropa im legendären Regiment „Normandie-Niemen«.
Andererseits kann man nicht wegschauen: Von 1940 bis 1944 existierte in Frankreich de facto ein Deutschland freundschaftlich gesinntes Regime. Es kooperierte wirtschaftlich aktiv mit den Nazis, half den „älteren Partnern« bei der Vernichtung der Juden und versuchte sogar, am „Kreuzzug gegen den Bolschewismus« teilzunehmen. Wie konnte es dazu kommen, dass die Heimat der Menschenrechte und die Bastion republikanischer Werte versuchte, mit einer der hässlichsten und unmenschlichsten Diktaturen der Weltgeschichte zu koexistieren?
Und wer sind die Richter?
Im Herbst 1944 wusch sich das befreite Frankreich eilig von allen braunen Flecken rein. Der Krieg war noch im Gange, doch die wegen Kollaboration verdächtigten Mitbürger wurden bereits vor Sondergerichten erwartet. Am 19. Januar 1945 verhandelte eines dieser Tribunale den Fall von Robert Brasillach.
Zeitgenossen brauchten keine Erklärung, wer dieser 35-jährige Journalist und Schriftsteller war und wofür er vor Gericht stand. Schon vor dem Krieg hatte Brasillach sich durch die Verbreitung einer extrem rechten Agenda einen lauten und zugleich zweifelhaften Ruf erworben. Der gebürtige Südokzitanier forderte entweder das endgültige Aus für die sterbende französische Demokratie der 1930er Jahre oder die endgültige „Lösung der Judenfrage« im Land.

Brasillachs Erscheinungsbild passte kaum zu seinen Hassreden. Der brutale Ultrarechte wurde von einem schwächlichen kleinen Mann mit kindlichem Gesicht hinter dicken Brillengläsern gespielt. Zudem wussten alle um Brasillachs Homosexualität. Dennoch sah der Literat keinerlei innere Widersprüche, änderte seine Ansichten nicht und betrachtete die militärische Niederlage seines Landes im Sommer 1940 als Chance für dessen Wiedergeburt. „Ich glaube, ich bin eine Verbindung mit dem deutschen Genie eingegangen, die ich nie vergessen werde. Ob es uns gefällt oder nicht, wir werden zusammenleben.«
Brasillachs Zeitung Je suis partout („Ich bin überall«) wurde für viele Franzosen zum Synonym für die Besatzung und das Vichy-Regime. Dort freute sich der Kollaborateur über das Ende der Dritten Republik („alte syphilitische Hure«), rief dazu auf, den Widerstand zu zerschlagen, und verherrlichte antijüdische Razzien mit anschließenden Deportationen der Opfer ins Reich. Ja, in Frankreich von 1940 bis 1944 grüßten viele mit dem Hitlergruß, aber so ehrlich, leidenschaftlich und kreativ wie Brasillach taten es nicht einmal die hochrangigen Vichy-Anhänger.
„Ratten, denen das Aussterben drohte, schworen, dass sie in Wirklichkeit Katzen seien, exotische Katzen aus Siam und Persien und deshalb schwer zu erkennen. Sie zeigten sogar Papiere, die belegten, dass sie Katzenmütter, Katerväter, Katzen-Großmütter und Großväter hatten. Infolgedessen trifft man in Paris, das von Ratten zerfressen, ausgesaugt und gefressen wird, keine einzige, wenn man anfängt, danach zu suchen. Ich weiß nicht, warum mich diese Geschichte an die Juden erinnert.«
– aus dem journalistischen Nachlass von Robert Brasillach
Nach der Befreiung verließ Brasillach die Deutschen nicht. Er blieb in Frankreich, versteckte sich eine Zeit lang, ergab sich dann aber freiwillig den Behörden der wiederhergestellten Republik. Das Gericht verurteilte den Kollaborateur im Januar 1945 zum Tode, woraufhin der Verurteilte nervös wurde und seine Feinde um Gnade bat. Doch General Charles de Gaulle, der damals die Übergangsregierung leitete, lehnte ab. Am 6. Februar 1945 wurde Brasillach erschossen.

Die Hinrichtung des Chefredakteurs von Je suis partout löste in der französischen Gesellschaft eine langanhaltende Debatte aus. Das Urteil gegen Brasillach verurteilte öffentlich der Widerstandskämpfer und Schriftsteller François Mauriac: Man solle keine Märtyrer für eine unrichtige Sache schaffen, der Verräter solle lieber im Gefängnis verfaulen. Andere störte, dass Brasillach, der nie ein Geheimnis daraus gemacht hatte, erschossen wurde, während Tausende „leise« Kollaborateure – Beamte, Lebensmittel-Lieferanten der Wehrmacht, Bauunternehmer für dieselbe – ruhig in der wiederhergestellten Republik lebten. Wieder andere bezweifelten die Gerechtigkeit des Januargerichts. Dessen Vorsitzender hatte wie der Angeklagte während der Besatzungszeit für die Vichy-Regierung gearbeitet.
Brasillach blieb nicht das einzige Opfer im Kampf für eine unrichtige Sache. Von 1944 bis 1951 wurden in Frankreich über 6700 Menschen wegen Kollaboration zum Tode verurteilt, und etwa ein Viertel dieser Urteile wurde durch Soldaten vollstreckt. Das Land versuchte, seinen Namen zu reinigen und die „schwarzen« vier Jahre aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Aber was hatten die Franzosen in dieser Zeit eigentlich angerichtet?
Hauptsache, kein Krieg
Das Verhalten der französischen Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg lässt sich teilweise durch ihre Erfahrungen im Ersten Weltkrieg erklären. Von 1914 bis 1918 kämpften die Franzosen im Gegensatz zu anderen Großmächten auf eigenem Boden. Manchmal wurde sogar Paris zur Frontstadt.
Die Verluste der Franzosen waren enorm: über eine Million Tote, mehr als 5 % der männlichen Bevölkerung. Besonders erschreckend war die Lage in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren, wo die Sterblichkeitsrate an der Front monströse 30 % erreichte. Die Nachkriegsrealität prägten zahllose Waisen, Krüppel, Witwen und unverheiratete Frauen. Unter diesen Umständen ist die massive Ablehnung einer neuen Kriegsidee verständlich. Zumal Frankreich 1919 mit dem Versailler Vertrag alle politischen Ziele erreicht hatte.
„In Frankreich herrschte landesweite Trauer um die Kriegstoten. Der schwer errungene Sieg wurde sehr schwer empfunden, gestützt von der Hoffnung, dass die Bosche [Deutsche] für alles mit Reparationszahlungen bezahlen würden. Man glaubte, alles zu tun, damit der Krieg von 1914 bis 1918 le dernier des derniers, „der letzte der Letzten« sei««
– Jewgenija Obitschkina, russische Historikerin
In den 1930er Jahren erhielt der Pariser Pazifismus jedoch einen ungewöhnlich scharfen Ton. Paradoxerweise verfiel ein spürbarer Teil der Gesellschaft in Anglophobie. Und zwar wurde der wichtigste Verbündete gerade in rechten Kreisen nicht gemocht. Große Geschäftsleute, hohe Beamte und Armeegeneral sahen in den Briten feige Trittbrettfahrer, die sich die Hände nicht schmutzig machen wollten. Sollte ein neuer Krieg ausbrechen, war die Frage, ob man mit dem „listigen Albion« überhaupt zusammen kämpfen sollte.

Die antibritanischen und daraus resultierenden antiamerikanischen Stimmungen verstärkte die Große Depression. Aus makroökonomischen Gründen erreichte die Krise Frankreich erst Mitte der 1930er Jahre. Dies gab der extremen Rechten Anlass, den Anstieg der Arbeitslosigkeit und den Bankencrash als Machenschaften listiger Angelsachsen zu erklären, hinter denen offensichtlich jüdische Finanzmagnaten stünden.
Frankreich blieb zwar eine parlamentarische Republik, in der gemäßigte Parteien dominierten. Doch in Europa wurden Demokratien in den 1930er Jahren nicht geschätzt: Die Nachbarn verfielen nacheinander in Autoritarismus. Und immer mehr Franzosen fragten sich: Was nützt die Dritte Republik, wenn Regierungen wirtschaftliche Probleme nicht lösen und bei ersten Schwierigkeiten zurücktreten?
Sogar Kommunisten grüßen mit dem Hitlergruß
Zwischen 1930 und 1940 wechselten in Paris 28 Ministerien. Grundsätzlich änderte sich dabei nichts – die Macht blieb in den Händen eines kleinen Kreises von Politikern, die meist Mitglied in Freimaurerlogen waren oder andere informelle Beziehungen pflegten. In diesem unruhigen Jahrzehnt bildete der Sozialist Pierre Laval (zukünftiger Premierminister im Vichy-Regime) vier Regierungen, der Zentrist Édouard Daladier (Teilnehmer des Münchner Abkommens) sogar fünf.

Die französische Politik verfiel in ein internes Gerangel, in dem der Wille der Wähler wenig zählte und wichtige Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen wurden. Von 1936 bis 1938 versuchte der ehrlichste Teil der französischen Politik, das System zu brechen. Zweimal kam die Volksfront-Regierung an die Macht, eine breite linke Koalition unter Führung des Sozialisten Léon Blum. Doch alle ihre Versuche, umfassende Sozialreformen durchzusetzen, scheiterten. Wie der britische Historiker Julian Jackson später schrieb, „hinterließ die Volksfront nur Misserfolge und Enttäuschungen«.
Der Zusammenbruch der Blum-Regierungen festigte einen bereits erkennbaren Trend der breiten Enttäuschung am Sozialismus. Führende Aktivisten der Linken überdachten ihr Programm und wandelten sich zu ultrarechten Populisten. Ein Fakt genügt: 1936 gründete Jacques Doriot die pronazistische PPF (Parti Populaire Français, „Französische Volkspartei«), ehemaliges Mitglied des Politbüros der örtlichen KP, der Moskau besucht und Lenin persönlich gekannt hatte.

Zweifellos kann Doriots Handeln als Verrat gewertet werden, doch zeigte sich der zukünftige Kollaborateur in gewisser Weise als wahrer Politiker. Der ehemalige Lenin-Anhänger folgte seinem Wählerkreis, und gegen Ende der 1930er Jahre bevorzugten immer mehr Franzosen nicht die traditionellen Tugenden der Republik, sondern Führerprinzip, Antisemitismus und ethnischen Nationalismus. Wie ein anderer ultrarechter Anführer, Marcel Bucard, Chef der feindlichen PPF-„Bewegung der Franzisten«, erklärte:
„Unsere Väter wollten Freiheit – wir fordern Ordnung. Sie predigten Brüderlichkeit – wir fordern die Disziplin der Gefühle. Sie verkündeten Gleichheit – wir behaupten die Hierarchie der Werte«
So war Frankreich am 3. September 1939 in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Die Straße gehörte den Ultrarechten; dieselbe PPF kooperierte eng mit dem Verbrechen in den südlichen Hafenstädten. Und in den hohen Kabinetten saßen Herren, die keineswegs brannten, Deutschland bis zum Tod zu bekämpfen.
Cherchez la femme
Die vorletzte Regierung der Dritten Republik wurde von einem nicht schlechten Kandidaten geführt, dem Liberalen Paul Reynaud. Er stand eindeutig für den Widerstand gegen die Nazis. Doch der äußerlich würdige Premierminister legte unabsichtlich eine Mine unter seinen eigenen Staat.
Unverhältnismäßiger politischer Einfluss fiel unter Reynaud seiner eigenen Geliebten zu, Gräfin Hélène de Port. Spötter nannten sie Die Seitentür (La porte à côté), mit einem klaren Hinweis – über die Gräfin ließ sich vieles hinter dem Rücken ihres Partners im Schlafzimmer regeln. Mit Kriegsbeginn wurde das Wohnzimmer der de Port zu einem Zirkel anti-britischer, anti-republikanischer und pro-deutscher Kräfte. Ihr Idol war der 84-jährige Marschall Philippe Pétain, allgemein anerkannter Held des Ersten Weltkriegs.

Es wurde gemunkelt, dass Mitte der 1930er Jahre die extremen Rechten Pétain einen Putsch gegen die Demokraten anboten, doch der Alte hielt sich zurück. Gleichzeitig trug der Marschall indirekt zu der bevorstehenden militärischen Katastrophe Frankreichs bei. Er nutzte seinen Einfluss in der Armee, um zwei verhängnisvolle Thesen durchzusetzen: Die Entwicklung der Panzertruppen sei unverhältnismäßig teuer, und der Bau von Befestigungen in den Ardennen an der belgischen Grenze sei unnötig, da dort ohnehin unüberwindbare Berge lägen. Wie bekannt, lief im Frühjahr 1940 alles anders als Pétain prognostiziert hatte.
Bis Mitte Juni brach die Front zusammen, die britischen Verbündeten segelten auf ihre Insel zurück, und der eigentlich kampfbereite Reynaud fand sich politisch isoliert. Am 16. Juni trat der gescheiterte Politiker zurück, und Pétain übernahm das Amt, der offen zu einem Waffenstillstand mit den Deutschen aufrief. Dies erklärte er dem eilig auf das Festland gereisten Winston Churchill.
„Churchill versuchte zu überzeugen, dass die Franzosen falsch lägen, und zitierte die Worte [des Premierministers im Ersten Weltkrieg Georges] Clemenceau: „Ich werde vor Paris, in Paris und für Paris kämpfen«. Pétain antwortete „ruhig und würdevoll« und wies darauf hin, dass Clemenceau noch eine strategische Reserve von 60 Divisionen hatte, die es jetzt nicht mehr gibt. Die Zerstörung von Paris wird den Kriegsverlauf nicht beeinflussen«
– John Norwich, britischer Historiker
Am 17. Juni 1940 rief Pétain die Franzosen auf, den aussichtslosen Kampf einzustellen. Wie er sagte, würden die Deutschen in den nächsten Wochen „den Engländern die Hälse abdrehen wie Küken«. Bereits am 22. Juni unterzeichneten die Parteien im Wald von Compiègne den entsprechenden Vertrag, einen Triumph für das Dritte Reich und zugleich eine Trauer für die Dritte Republik. Auf Hitlers Drängen nahmen die deutschen Generäle die Kapitulation des Gegners nicht nur an dem Ort entgegen, an dem 22 Jahre zuvor der Erste Weltkrieg endete, sondern buchstäblich im selben Kommandowagen – um symbolisch den bitteren Herbst 1918 für die Deutschen zu tilgen.

Frankreich lag hingegen wie gelähmt da. Die nördlichen Departements wurden entvölkert, und die Straßen nach Süden füllten sich mit Flüchtlingsströmen. Fast jeder in der unterlegenen Armee hatte Verwandte im Dienst, doch niemand konnte sagen, was nun mit 1,8 Millionen Kriegsgefangenen geschehen würde. Vage Hoffnungen auf Besserung setzte man auf die Figur des neuen Regierungschefs – keinen zivilen Schwätzer, sondern einen echten Mann in Uniform. Schließlich verteidigte Pétain gegenüber den „Boschen« sowohl eine teilweise Souveränität Frankreichs als auch den Erhalt der Überseekolonien. Schon nicht so schlecht, wie es hätte sein können.
Um den Marschall formierte sich ein neues politisches Regime. Rechte Kreise verband die Überzeugung, dass die Katastrophe von Mai-Juni 1940 das logische Ende der „rückgratlosen« Republik sei: Demokraten hätten traditionelle Werte verraten, die Nation verdorben und sie in einen von vornherein verlorenen Krieg gezogen. Nun sei die Zeit, dies zu korrigieren. Wahrscheinlich glaubten die Leute um Pétain aufrichtig, sie retteten das Vaterland – sie konnten sich ja nicht einfach so dem Feind ergeben.
Triumph für den Kapitulanten
Am 3. Juli 1940 halfen den Pétain-Anhängern bei ihrem Popularitätserwerb ungewollt britische Seeleute. Bei Mers-el-Kébir in Algerien griff die Royal Navy eine Gruppe französischer Schiffe an, deren Offiziere zuvor das Ultimatum der ehemaligen Verbündeten abgelehnt hatten – die Schiffe zu übergeben oder selbst zu versenken. Die Briten zerstörten nur ein Schlachtschiff und beschädigten drei Transportschiffe. Dennoch kostete der strategisch unbedeutende Angriff in Mers-el-Kébir fast 1300 französischen Seeleuten das Leben.

Auf dem Kontinent überzeugte dieser Vorfall viele Unentschlossene: Die „Roastbeefs« sind viel gemeiner als die „Bosche«, und Pétain hat Recht, dass er mit den Inselbewohnern brach. Am 10. Juli 1940 erwartete den Marschall in der Stadt Vichy ein politischer Triumph. Die versammelten Abgeordneten beider Parlamentskammern stimmten für außergewöhnliche Vollmachten für Pétain als neuen Staatschef und die faktische Abschaffung der 65 Jahre bestehenden Dritten Republik (569 Stimmen „für« bei 80 „gegen« und 19 Enthaltungen).
„Unsere Niederlage ist das Ergebnis unserer Zügellosigkeit. Der Zustand der Willkür zerstörte alles, was durch Opferbereitschaft geschaffen wurde. Deshalb fordere ich Sie in erster Linie zu geistiger und moralischer Erneuerung auf«
– aus Pétains Rundfunkrede vom 25. Juni 1940
Die Feierlichkeit des Moments wurde durch den Ort der Zeremonie etwas getrübt. Die Organisatoren wählten das größte Kabarett in Vichy, da es in der Stadt keine größeren Räumlichkeiten gab. Die faktische Hauptstadt der „freien Zone« blieb im Kurort. Die von der Besatzung verschonten Großstädte – etwa Lyon, Toulouse oder Marseille – galten als zu republikanisch eingestellt oder schlicht kriminell.
Die ersten Schritte des neuen Regimes schreckten seine Anhänger nicht ab. Die Pétain-Regierung – geleitet vom sozialistischen Pierre Laval, der sich der Situation angepasst hatte – löste erfolgreich die Probleme des geschlagenen Landes. Die Vichy-Anhänger demobilisierten zügig die Reste der französischen Armee und halfen den im Mai 1940 geflohenen Nordfranzosen, in ihre Häuser in den bereits besetzten Departements zurückzukehren.

Außerdem erreichte Lavals Regierung vom Nazi-Regime die Freilassung einiger Kriegsgefangener. Die neuen Behörden bekämpften die Arbeitslosigkeit, setzten Höchstpreise fest und führten Sozialleistungen für bedürftige Bürger ein. Diese und ähnliche Initiativen wurden von einer für die Bewohner der Provinz verständlichen Rhetorik begleitet – Frankreich sei zu lange nicht es selbst gewesen und deshalb in der unfreundlichen Frühjahrssaison 1940 in Schwierigkeiten geraten.
Nun sei es an der Zeit, zum Ursprung zurückzukehren: zur Familie, zu den Feldern auf dem Land, zum angenehmen Halbdunkel der Kirche. Die Vichy-Anhänger gaben dem Klerus wieder die allgemeinen Schulen zurück, erschwerten die Scheidungsverfahren und führten Vergünstigungen für Städter ein, die sich für das Landleben entschieden. Nur waren die Farben und Helfer für die Darstellung dieser idyllischen Pastorale bei Marschall Pétain nicht gerade die passendsten.
Uneinbringliche Zusammenarbeit
Formal galt der erneuerte französische Staat als blockfreier Staat, der nicht am Zweiten Weltkrieg teilnahm. In diesem Status erkannten die Sowjetunion, die USA, die meisten europäischen Länder und sogar einige britische Dominions die Pétain-Regierung zunächst als legitime Macht an. Doch über dieser Neutralität hing von Anfang an ein Damoklesschwert.
Vor allem zwang das Dritte Reich Pétain zur Zahlung von Reparationen als „Kompensation für Besatzungskosten«. Bis Ende 1943 flossen auf dieser Grundlage fast 25 Milliarden Reichsmark in die deutsche Staatskasse. Die von Vichy festgesetzte Abgabe war so unverschämt, dass die Nazis sie auf allen möglichen Wegen eintrieben – von ausländischen Konzessionen bis zur Schlachtung von Vieh. Frankreich wurde faktisch zur Halbkolonie des Reiches, und die Hitler-Politik zerstörte direkt die Wirtschaft von Vichy.

Pétain und Laval holten im Gegenzug einige kompetente Persönlichkeiten in die Regierung, darunter Finanzminister Yves Bouthillier. Dieser präsentierte sich als Technokrat und betonte, dass er dem Faschismus fernstehe – er wolle dem Land nur in schweren Zeiten helfen. Die ersten anderthalb Jahre hielt der Minister tatsächlich eine Art normales Leben aufrecht: mit stabilen Preisen, festen Gehältern und einigermaßen sozialen Leistungen für die Bürger.
Doch im Winter 1942 drängten die ultrarechten Gegner Bouthilliers auf seinen Rücktritt, woraufhin die Vichy-Wirtschaft erwartungsgemäß zusammenbrach. Bis 1944 sank der Industrieproduktionsindex Frankreichs auf ein Zweieinhalbfaches unter dem Wert von 1938, und das Exportvolumen schrumpfte im gleichen Zeitraum um das Vierfache. Und was noch schlimmer war: Die Nazis vergifteten nicht nur das wirtschaftliche Leben der „freien Zone«.

Schon im Oktober 1940 zwangen die Deutschen die Franzosen, antisemitische Gesetze zu erlassen, die fast wortwörtlich von den deutschen Originalen abgeschrieben waren. Anfangs beruhigten sich viele Bürger damit, dass dies nur eine Formalität sei, um die Nachbarn zu besänftigen und mit ihnen weiter zusammenzuarbeiten (collaborer), wie es Marschall Pétain nach einem persönlichen Treffen mit Hitler forderte. Natürlich war das eine weitere Selbsttäuschung.
„Ich erinnere mich noch, wie ein Polizeibeamter, Franzose, kein Deutscher, meine Mutter beleidigte und schlug. Ich kann das nicht vergessen. […] Einige Franzosen wandten den Blick ab, um die jüdischen Frauen und Kinder nicht zu sehen, in welchem Zustand wir damals waren. Aber die Mehrheit erfüllte ihre Pflichten eifrig und emotionslos«
– Annette Müller, Zeitzeugin des Holocaust in Frankreich
Im Winter 1942 folgten neue „Rassengesetze«, die den französischen Juden alle Menschen- und Bürgerrechte entzogen. Im Sommer 1942 begann systematische Jagd auf die verfolgte Bevölkerung, und alle Gefangenen wurden sofort in Vernichtungslager im ehemaligen Polen deportiert. Insgesamt wurden mindestens 74.000 französische Juden Opfer des Holocaust, etwa ein Viertel der Vorkriegsbevölkerung der Gemeinde.
***
In gewisser Weise blieben die Franzosen sich treu, auch nachdem sie den rutschigen Weg der Kollaboration beschritten hatten. Im Gegensatz zu den meisten Satelliten des Reiches gab es hier mehrere pronazistische Parteien: die oben erwähnten „Franzisten« mit der PPF und ihre Konkurrenten mit verschiedenen ideologischen Schwerpunkten.
Nur verachteten die deutschen Partner alle ihre Nachahmer gleichermaßen. Keine der ultrarechten Kräfte erhielt Hitlers Segen: Nicht einmal die Bildung mehrerer Freiwilligenverbände für den Krieg gegen die UdSSR half. Und im Herbst 1942, nachdem die französischen Kolonien in Afrika begannen, auf die Seite der Alliierten zu wechseln, beschlossen die Berliner, den „Laden der freien Zone« zu schließen. Am 11. November 1942 besetzten deutsch-italienische Truppen ganz Frankreich.

Bis dahin hatte die schweigende Mehrheit der Franzosen erkannt, dass der einzige Weg zur Rettung des Landes nicht in Kompromissen, sondern im Kampf liegt, und das „Kämpfende Frankreich« von General de Gaulle war viel mehr als eine Privatarmee der unbeliebten Briten. Der Widerstand gegen die Nazis nahm endlich einen landesweiten Charakter an: sowohl im Mutterland als auch in den zahlreichen Besitzungen. Viele Bürger mussten ihre ursprünglichen Irrtümer aufgeben, und nicht wenige ihrer Landsleute mussten für alte Fehler mit ihrem Leben bezahlen.
So oder so konnte Frankreich sowohl seine Unabhängigkeit als auch seine nationale Ehre bewahren. Auch wenn dies manchmal von denselben Menschen getan wurde, die im unheilvollen Sommer 1940 fast ihr Land einem hochgiftigen Nachbarn ausgeliefert hätten.
„In den Begriffen ‚Kollaboration‘ und ‚Widerstand‘ lässt sich nicht alles beschreiben, was in Frankreich in den ‚schwarzen Jahren‘ geschah. Diese Begriffe bezeichnen zwei Pole, zwischen denen ein ganzes Spektrum von Situationen, Positionen und Stimmungen liegt, die sich über Zeit und Raum verändern. Ein Mensch konnte sich auf diesem Spektrum von einem Pol zum anderen bewegen, ohne ein vulgärer Opportunist zu sein. Zum Beispiel wurde [der spätere Präsident] François Mitterrand, anfangs ein leidenschaftlicher Anhänger Pétains, ein aktiver Teilnehmer des Widerstands. Sein Beispiel ist eine gute Illustration dafür, wie sich die Haltung vieler Franzosen entwickelte.«
– Henri Rousso, französischer Historiker
Hauptquellen des Artikels:
- Gaivoronski K. Tod des Propagandisten. Warum und wie der bekannteste französische Schriftsteller-Kollaborateur vor Gericht stand
- Micheev K. Sozial-ökonomische Politik der Vichy-Regierung in Frankreich
- Norwich J. Kurze Geschichte Frankreichs
- Obitschkina E. Das Vichy-Regime
- Ries L. Holocaust: Eine neue Geschichte
- Rousso H. Vichy-Frankreich und das Frankreich des Widerstands
- Evans R. Das Dritte Reich: Kriegstage
Auf dem Hauptfoto – der historische Handschlag zwischen Philippe Pétain und Adolf Hitler am 24. Oktober 1940. Nach dem Treffen rief der französische Marschall seine Landsleute zur „Zusammenarbeit« (collaborer) mit Deutschland auf – später erhielt dieses Wort eine negative Konnotation. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-H25217 / CC-BY-SA 3.0