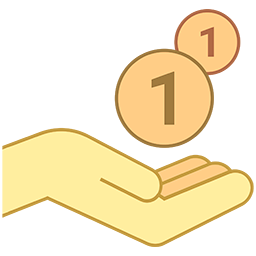Unterstützen Sie den Autor!
Der russische Schlangenschreiber. Zum siebzigsten Geburtstag von Vladimir Sorokin

Wir befinden uns schon lange in seinem unendlichen Tellurien, leben in seiner sich selbst erfüllenden Prophezeiung, tollen herum in der von ihm beschriebenen Maschine der Gewalt. Und man kann nicht sagen, dass wir nicht gewarnt wurden; eine so klare Vorhersage – in den letzten Jahrzehnten vor der Katastrophe – hat die russische Literatur noch nicht gekannt.

Die Veröffentlichung wurde vom Medienprojekt „Land und Welt – Sakharov Review« vorbereitet (Telegram-Kanal des Projekts – „Land und Welt«).
Wenn wir sagen, dass etwas „auf tschechowsche, tolstoische, dostojewskische Weise« geschieht, bedeutet das einen Blick auf die Welt durch einzigartige Linsen, die es ermöglichen, die Welt als Ganzes zu erfassen – aber jedes Mal anders. Die Welt „auf sorokinsche Weise« zu sehen bedeutet „Lachen durch das Unbewusste hindurch«, ein bitteres Schmunzeln eines Menschen, der die ganze Tragik seiner existenziellen Lage versteht.
Der sorokinsche Stil ist unter anderem sehr demokratisch; er lässt jeden herein – der natürlich will. Der „Kot«, der uns am Eingang erwartet (wie Sorokin-Gegner sagen), ist einfach eine radikale Forderung an die Persönlichkeit des 21. Jahrhunderts, die kritische Bereitschaft, sich nackt, ohne Stützen, dem Sein zu stellen. Allein zu bleiben mit dem erschreckenden Wesen des Geschehens, „die Wahrheit zu sagen« – vor allem zu sich selbst (Refrain aus Sorokins „Eis-Trilogie«).
Die Einhaltung äußerer Anstandsregeln, Treue zu Traditionen und die Absolutsetzung der Kultur als solcher waren keineswegs Hindernisse auf dem Weg zum Faschismus, schrieb Hannah Arendt. Und sie waren es auch nicht für andere Totalitarismen, möchten wir hinzufügen. Jegliche kulturelle Tabus helfen eher dem Totalitarismus als dass sie ihm im Weg stehen, da sie eine Sperre, eine Barriere für das Denken errichten und nicht erlauben, weiter zu denken, als es erlaubt ist.
Allerdings ist das Fehlen von Tabus auch kein Allheilmittel.
Der Postmodernismus wurde in Russland in den 1990er-2000er Jahren auch als „alles ist erlaubt« verstanden. Und diese sorglose Animalität durch zynisches Lachen ist ein deutliches Zeichen des neuen Bösen.
Der einzige Trost ist, dass das Böse heute nicht einmal mehr Illusionen über sich selbst aufbaut. Diese Nacktheit, Offenheit des Bösen, „ohne Theorien« – hoffentlich hilft das in historischer Perspektive, sein Wesen viel schneller zu erkennen als früher.
In der UdSSR war es üblich, verdienten Schriftstellern zum 70. Geburtstag den Titel „Held der sozialistischen Arbeit« zu verleihen (im Jargon jener Zeit „Gertruda« genannt). Im Fall Sorokin klingt das wie ein vorgefertigter Witz. Aber seine kreative Methode erlaubt uns, auch so eine Utopie vorzustellen. Nehmen wir an, das „schöne Russland der Zukunft« möchte Sorokin für die geschenkten Bedeutungen danken und lädt ihn in den Kremlpalast ein, um ihm einen goldenen Stern an das Jackett zu heften. Erstens ist das selbst unter besten Umständen kaum vorstellbar: vor allem, weil keine Machtidee, auch keine „gute«, mit Sorokin vereinbar ist. Zweitens würden Menschen, die mit Sorokins Büchern aufgewachsen sind (sofern sie ihn richtig verstanden haben), den Kreml höchstwahrscheinlich in einen „Zuckerpalast« verwandeln – in eine Art Vergnügungsattraktion und nicht in ein Symbol der Macht.
Sorokin hat eine andere Auszeichnung verdient, symbolisch: dass die Menschen dem Bösen aufmerksamer begegnen. Ein Signal für ideologische Falschheit ist in der Regel ästhetische Falschheit: der frühe Sorokin, der den Sozialrealismus mit seinen kartonhaften Helden und Reden „in den Bauch geschlagen« hat, ist ganz davon geprägt. Dabei – ein Paradoxon: Sorokin ist sehr russisch-klassisch. Er denkt in großen Brocken, großen Konzepten – und in der Massigkeit seines Talents ist er ein Erbe der tolstoischen Tradition in der russischen Literatur. Eine der besten Charakterisierungen Sorokins, die ich gehört habe: „der ungehorsame Sohn Tolstois«. Lustigerweise ist auch Tolstoi selbst (im Gegensatz zu Dostojewski!) kaum vorstellbar, wie er zum Herrscher in den Palast kommt, um eine Auszeichnung zu erhalten.
Man kann nicht sagen, dass die russische Literatur sich zuvor nicht mit Gewalt beschäftigt oder vor dem Problem gewarnt hätte. Aber Sorokin hat das am konsequentesten getan, von Beginn seines Schaffens Ende der 1970er – Anfang der 1980er Jahre. Der Sozialrealismus liebte es, Worte über Menschlichkeit zu wiederholen, „Mensch zu bleiben!« (natürlich gegenüber den eigenen Leuten, nicht gegenüber den Feinden der sowjetischen Macht). In diesem Sinne entspricht Sorokin durchaus dem früheren Kanon: Gewalt ist in erster Linie menschlich.
Sowohl die vorrevolutionäre als auch die sowjetische Kultur (sowohl die offizielle als auch die dissidente) waren überzeugt, dass wir im Großen und Ganzen „gut« sind, nur das System schlecht ist. Es reicht, das System zu verbessern – zum Beispiel mehr aufzuklären oder besser zu ernähren, wenn nicht mit Nahrung, dann mit Ideen – und der Mensch wird besser. Nach Sorokin ist die russische Kultur gezwungen anzuerkennen, dass die „Schlechtigkeit« des Menschen etwas Wesentliches ist, ihm von Anfang an innewohnt.
Dmitri Bykow (ebenfalls ein Bewunderer Sorokins) hat ein Gedicht aus den 1990er Jahren, das besagt, dass nicht so sehr die praktischen Gewalttaten erschreckend sind, sondern das Bewusstsein, dass sie „möglich« sind.
Sorokin hat gezeigt, dass der Mensch selbst, sowjetisch oder postsowjetisch, zu allem fähig ist, zum Schlimmsten. Und heute wird diese Annahme durch Millionen von Beispielen bestätigt – mit sorokinscher Unmittelbarkeit; Massenmord ist ein lukratives, profitables Geschäft geworden, und Millionen sind damit beschäftigt.
Ein anderes Thema, ein durchgehendes Motiv bei Sorokin in den letzten Jahrzehnten, ist der Untergang der russischen Kultur im 21. Jahrhundert, das allmähliche Verschwinden dieser Währung aus dem Weltumlauf. Das schrecklichste Bild bei Sorokin – in „Das Erbe« (2023) – ist, wie in einem post-russischen Staat Dampflokomotiven mit menschlichen Leichen versenkt werden. Das ist ein Symbol der Entmenschlichung, klar. Aber dieses Bild hat auch eine andere Deutung: In den letzten 20-30 Jahren hat die russische Kultur ihren Dampflokzug mit Themen und Ideen toter Klassiker, mit Geist und Hoffnungen der Vergangenheit versenkt. Anfangs gab das eine gewisse Hitze, aber die Reserven sind erschöpft. Und neue Reserven wurden nicht geschaffen.
In den 1990er Jahren gab es Hoffnung – auf eine allgemeine Verbesserung der Sitten. Irgendetwas unvermeidlich Gutes sollte von selbst passieren – schließlich hat man in der Vergangenheit so viel gelitten, außerdem – „das ist doch so natürlich!« (in diesem Glauben waren wohl Nachklänge der früheren marxistischen Überzeugung von der „Gesetzmäßigkeit der Geschichte, der treibenden Kräfte« usw.). Natürlich wird das Sowjetische nicht sofort verschwinden – ihm steht eine Phase des Zerfalls bevor. Symbolisch für diesen Zerfall war die berühmte Kurzgeschichte Sorokins aus „Norm« (1979), die im Volk „Martin Alexejewitsch« genannt wird. Die sich im Kreis drehende Rede der Hauptfigur, das Flackern seines Bewusstseins zwischen Banalität und Wahnsinn – so dachten viele – ist der Prozess des Zerfalls des Sowjetischen, in Moleküle, in Atome der Sprache. Bevor es endgültig ins Nichts verschwindet, muss das Sowjetische sich bis zum Buchstaben, bis zum Interjektion aussprechen, alles bis zum Punkt auskotzen. Und die neue Propaganda wurde als solcher „Martin Alexejewitsch« angesehen, die letzte Phase des sprachlichen Kontrollverlusts. „Aber irgendwann werden sie sich endgültig aussprechen!« – so dachte man.
Das war ein weiterer allgemeiner Irrtum – und wohl auch Sorokins eigener –, dass das totalitäre Bewusstsein von selbst verschwinden würde. Es verschwindet nicht von selbst – das ist die tragischste Erkenntnis des 21. Jahrhunderts. Damit es verschwindet, sind Anstrengungen von jedem nötig (allerdings ist unklar, welche genau: Appelle an Vernunft und Rationalität sind, wie wir sehen, kein Schlüssel zum totalitären Bewusstsein). Das Totalitäre erwies sich als fähig zur unendlichen Selbstreproduktion – und zwar mit jedem Mal in immer erschreckenderen Formen. Die neue Inkarnation des „Martin« – der Philosoph Dugin, der allen vorschlägt, gemeinsam im Feuer der Geschichte auf einem nuklearen Spieß zu verbrennen und sich so endlich „zu reinigen«.
Welche Worte aber heute finden, um dieses russische Experimentierfeld aufzulockern, ohne es vollständig zu verbrennen? Das Paradox der postkatastrophalen Zeit: Viele Worte aus dem früheren Lexikon erscheinen jetzt unendlich falsch. Heute kann man nur das lesen, was keinen schnellen Ausweg aus dem Alptraum verspricht: Kafka, Beckett, Harms – und Sorokin.
So unerwartet ist es, dass Sorokin heute versucht, Trostworte zu finden – wofür er oft auf märchenhafte, volkstümliche Erzählungen zurückgreift. Die märchenhafte Zeit ist unendlich, nicht normiert – in diesem Sinne besitzt sie eine gewisse Widerstandskraft. Ein weiterer wichtiger Punkt: Das Märchen ist ein Mechanismus vielfacher Initiation, die Fähigkeit des Helden zur Selbsterneuerung. Allerdings muss der Märchenheld dafür eine Reihe von Prüfungen bestehen. Ob er sie besteht – und wir mit ihm – weiß nur Gott; aber diese Sicht auf die schreckliche Wirklichkeit bietet zumindest psychologische Unterstützung – und lässt die Option auf Hoffnung offen.