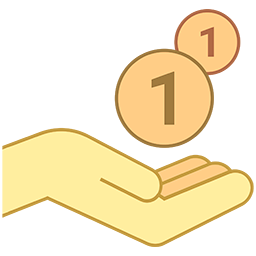Unterstützen Sie den Autor!
«Verschwinde aus Russland, ich bring dich um und mir passiert nichts»

Vor zwei Jahren hat das Oberste Gericht der Russischen Föderation die «internationale LGBT-Bewegung» als extremistische Organisation eingestuft. Seitdem kann allein die Tatsache der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität als Vorwand für einen Extremismusvorwurf gegen diejenigen dienen, die ins Visier des Staates geraten. LGBT-Personen haben Angst, sich an Polizei oder Gerichte zu wenden, selbst wenn sie selbst Opfer von Straftaten wurden. Hier sind die Geschichten von drei Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben.

Alle Namen der Protagonist*innen wurden aus Sicherheitsgründen geändert. Im Text kommt explizite Sprache vor.
«Die Ermittler werden dir nie glauben, wenn du so einen Ballast im Handy hast»
Andi, 18 Jahre alt, schwul
Andi lebte im Moskauer Vorort Pawlowski Possad und ging im Januar 2023 in die neunte Klasse. Zu dieser Zeit begann er, sich offen als homosexuell zu zeigen, lief mit langen, weiß gefärbten Haaren herum und sah nach eigenen Worten für eine Kleinstadt «etwas auffällig» aus. Das Verhältnis zu seinen Mitschülern war immer angespannt, und nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurde es nur noch schlimmer: Andi machte kein Geheimnis aus seiner ukrainischen Herkunft und seiner Ablehnung der «militärischen Spezialoperation». «All das zusammen hat den Hass ausgelöst», fasst er zusammen. Er erzählt, wie er einen organisierten Angriff in der Schule überlebte.
Insgesamt waren es acht Angreifer, einer von ihnen filmte das Geschehen. Ein Schüler aus einer Parallelklasse lockte Andi unter dem Vorwand eines Gesprächs aus der Kantine. Mit den Worten «du Schwuchtel» und «du tust so cool» schlug er Andi und stieß ihn zu einer Gruppe von Freunden, die ihn von hinten an den Armen packten. Sie hielten Andi fest, damit er sich nicht gegen die Schläge ins Gesicht wehren konnte, die ein anderer Schüler austeilte. Die Lehrer beendeten die Schlägerei zwar schnell, aber innerhalb von 30 Sekunden hatten die Jungs Andis Nase gebrochen, und er blutete. Er hoffte, das medizinische Personal der Schule würde ihm helfen oder einen Krankenwagen rufen. Stattdessen rief einer der Erwachsenen die Polizei. Andi war erleichtert: «Ich dachte, jetzt wird mir geholfen.»
Die herbeigerufene Polizeimajor brachte alle Angreifer zum Schulleiter. «Seid ihr verrückt geworden? Wollt ihr euer Leben in einer Strafkolonie beenden?», hörte Andi, während er vor der Tür zum Schulleiterzimmer saß. Das Gespräch dauerte etwa 15 Minuten, dann wurden die Jungs nach Hause geschickt. Sie lachten, als sie hinausgingen. Danach wurde Andi ins Büro gerufen – und kam erst zwei Stunden später, schockiert und weinend, wieder heraus.
Ohne die Eltern des verprügelten Jugendlichen zu informieren, schloss die Sozialpädagogin das Büro ab, und die Polizistin sagte: «Jetzt reicht’s. Jetzt wirst du uns alles erzählen und zeigen.»
Die Sozialpädagogin erklärte, Andi sei ein Extremist, und die Polizistin fügte hinzu, sie arbeite genau an der «extremistisch-terroristischen Linie». Heute erscheint Andi das seltsam – denn das Urteil des Obersten Gerichts zur Einstufung der «internationalen LGBT-Organisation» als extremistisch gab es damals noch gar nicht.
«Ich hatte große Angst», gibt er zu.
Dann behaupteten die Polizistin und die Sozialpädagogin, sie hätten angeblich ein Video, auf dem Andi «mit einer Fahne durch die Schule läuft». Auf die Frage, um welche Fahne es gehe, antwortete die Majorin: «Du weißt es selbst, hol sie raus.» Andi glaubt, dass die beiden sich das nur ausgedacht haben, um ihn einzuschüchtern: Er hatte nie eine Fahne. Dann forderte die Majorin ihn unter Androhung einer Festnahme auf, sein Handy zu entsperren und ihr zu geben. Er musste gehorchen.
«Ich war 15 Jahre alt und fing gerade erst an, mich selbst zu akzeptieren – meine Identität, meine Sexualität», erzählt der junge Mann. Auf seinem Handy gab es Sprachnachrichten von einem Jungen – «die erste gefühlvolle Korrespondenz, in der wir uns gegenseitig anzügliche Sprüche schickten.» Die Majorin hörte sie auf Lautsprecher ab und verurteilte Andi gemeinsam mit der Sozialpädagogin, während er weinte. «Ich saß da, in Tränen, blutend, ohne irgendetwas – kein Wattebausch, kein Taschentuch. Es war einfach nur demütigend», erinnert er sich.
Andi hatte große Angst, dass seine Familie von dem Vorfall erfahren würde. Als die Polizistin fragte: «Wissen deine Eltern, dass du schwul bist?» und er «nein» antwortete, nutzte die Majorin das als Druckmittel. Sie blätterte lange durch seine Chats, fotografierte den Handybildschirm und fragte schließlich, was an diesem Tag passiert sei. Als er von dem Angriff erzählte, grinste die Polizistin: «Was, so einfach haben sie dich verprügelt? Du musst verstehen, dass die Ermittler dir das nie glauben werden, wenn du so viel Ballast auf dem Handy hast.»
Dann fand die Majorin Andis privaten Telegram-Kanal mit fünf Abonnenten, auf dem er Memes über LGBT und die Ukraine postete, und erklärte, das sei Extremismus und die Demonstration verbotener Symbole. Zuerst drohte sie, die gesammelten Beweise Andis Eltern zu zeigen, dann drohte sie, ein Strafverfahren einzuleiten, falls der Junge Anzeige gegen die Angreifer erstatten wolle. Andi erinnert sich, dass er die ganze Zeit vor Angst zitterte: «Sie sagte mir, ich solle jetzt mit allem aufhören, und dann würde sie, ausnahmsweise, kein Strafverfahren gegen mich einleiten.»
Mit diesem Ultimatum endete das Gespräch. Andi akzeptierte die Bedingungen der Polizistin und wandte sich an niemanden, aber seinen Eltern erzählte er schließlich davon. Als er weinend nach Hause kam, sagte er, er sei wegen seiner Unterstützung für LGBT angegriffen worden, erwähnte aber nicht seine Zugehörigkeit zur queeren Community. Die Eltern glaubten ihm, doch am selben Tag schlug der Vater Andi mit den Worten: «Na klar, hast du dir die Haare wie ein Mädchen wachsen lassen. Natürlich halten dich alle für eine Schwuchtel. Und sie haben recht.»

Etwa drei Wochen nach dem Angriff fand in Andis Klasse ein Elternabend statt – danach schrieben zwölf Eltern eine Anzeige gegen Andi bei der Polizei, mit der Begründung, «unsere Väter sind an der Front» (eine Kopie des Dokuments liegt der Redaktion vor). Andi merkt an:
Obwohl beim Angriff gegen ihn vor allem Homophobie das Motiv war und nicht seine politischen Ansichten, stand in der Anzeige nichts über LGBT. Die Eltern der Mitschüler forderten eine Überprüfung nach Artikel 282 des Strafgesetzbuchs (Anstiftung zu Hass oder Feindschaft) wegen seiner Antikriegshaltung.
Nach der Anzeige wurden Andi und seine Eltern zur Polizei geladen, wo dieselbe Polizistin anwesend war, die ihm zuvor gedroht hatte. Zu ihrer Ehre verschwieg sie gegenüber den Eltern die intime Korrespondenz, die sie auf seinem Handy gefunden hatte – sie erwähnte nur, dass Andi LGBT in seinen Posts unterstütze. Und sie fügte hinzu: «Das haben wir alles unter uns geregelt, das bleibt zwischen uns. Und das, was [in der Anzeige] über die Ukraine steht, ist Unsinn, das ist komplett erfunden.»
Im Beisein der Eltern schrieb die Polizistin eine «Ablehnung» des Falls wegen fehlender Beweise. Andi erinnert sich, wie froh er war, dass die Eltern ihn im Innenministerium verteidigten und sagten: «Er hat einen Fehler gemacht. Er hat einfach etwas verwechselt. Er ist eigentlich ein sehr guter Junge.» Doch zu Hause gaben sie Andi weiterhin die Schuld an dem Geschehenen.
In der Schule versuchten dieselben Schüler, die Andi angegriffen hatten, ihn erneut zu verprügeln und beleidigten ihn weiterhin bei Begegnungen und in sozialen Netzwerken. Er erinnert sich, wie eine Gruppe Jungs auf der Straße an ihm vorbeiging und rief: «Hat dir gefallen, dass du verprügelt wurdest? Wir hätten dich noch in den Arsch ficken sollen.» Auch die Eltern warfen Andi die Geschichte ständig vor, und die Erinnerungen daran quälten ihn. Nach der neunten Klasse wechselte er die Schule. Dort wussten Lehrer und Schüler zwar schon von dem Angriff, aber es gab zumindest keine offene Aggression mehr.
Mit 18 Jahren zog Andi nach Spanien, um dort Asyl zu beantragen. Panikattacken und Flashbacks verfolgten ihn bis zu seiner Ausreise. Der junge Mann erinnert sich, dass er trotz allem nicht aus Russland wegwollte. Aber drei Monate nach dem Angriff kam das Gefühl: So kann es nicht weitergehen. Besonders nachdem Andi einen Jungen kennengelernt hatte, in den er sich verliebte: «Er war ein innerlich homophober Typ, hatte große Angst vor all dem. Das hat mir den Rest gegeben, denn zu den posttraumatischen Belastungen und dem Stress kam noch dazu, dass wir uns immer verstecken mussten. Ich habe verstanden, dass man so nicht leben kann.»
So kam Andi zu dem Entschluss, Russland zu verlassen. Mit seinen Eltern hat er keinen Kontakt mehr.
«Was, wenn ich mehr von den Strafverfolgungsbehörden zu befürchten habe?»
Denis, 27 Jahre alt, schwul
Anfang August 2025 kehrte Denis nach einem abendlichen Kinobesuch in Moskau nach Hause in den Moskauer Vorort zurück. Um drei Uhr nachts, als er schon fast zu Hause war, versperrten ihm drei Männer auf E-Scootern den Weg. Sie gaben sich als Mitglieder einer Neonazi-Organisation aus (der Redaktion ist der Name bekannt, wird aber aus Sicherheitsgründen nicht genannt), fragten, ob Denis Drogen nehme, und forderten, sein Handy zu zeigen. Denis sagt, er habe «konventionell maskulin» ausgesehen, aber den Männern gefielen seine Stimme und sein T-Shirt nicht – ein normales rotes T-Shirt mit Textprint, ohne Bezug zu LGBT.
Denis sagte ihnen, dass sie kein Recht hätten, von einem Fremden auf der Straße zu verlangen, das Handy zu entsperren und ihn zu verhören. Da wurde den Männern klar, dass Denis «nicht sehr heterosexuell» ist, und sie begannen, ihn zu beleidigen: «Warum benimmst du dich wie eine Frau?», «Guckt euch sein T-Shirt an, so was tragen nur Schwuchteln», «Der ist bestimmt auf Meth.»
Als sie Denis zu schubsen begannen, versuchte er zu fliehen, aber die Angreifer holten ihn ein und rissen ihn zu Boden. Sie drehten ihm die Arme auf den Rücken und zogen ihm das Handy aus der Tasche, «während sie mir erzählten, was sie mit mir machen und in welche Öffnungen». Am Ende fuhren die drei auf ihren Scootern mit seinem Handy davon.
Noch immer unter Schock ging Denis nach Hause, holte seinen Pass und ging zur nächsten Polizeistation – buchstäblich zwei Minuten vom Tatort entfernt. Der Ermittler war nicht da, und während Denis auf ihn wartete, fertigte er aus dem Gedächtnis Porträts der Angreifer an. Er überlegte, ob er der Polizei ehrlich von den Beleidigungen und dem seelischen Schaden erzählen oder nur den Diebstahl melden sollte.

Der Ermittler, der schließlich kam, war jünger als Denis und machte einen «vernünftigen» Eindruck, wie Denis sagt. Also entschied er sich, alles offen zu erzählen, und die Formulierung über Beleidigungen wegen sexueller Orientierung wurde in die Anzeige aufgenommen. Wenige Tage später wurde er in eine andere Dienststelle gerufen, um sich eine Videoaufnahme anzusehen, auf der der Angriff teilweise zu sehen war. Man sah, wie Denis angehalten wurde und davonlief, aber der Moment, in dem er zu Boden gestoßen und das Handy geraubt wurde, war nicht zu sehen. Noch einen Tag später zeigten die Polizisten ein Foto eines Verdächtigen, und Denis erkannte ihn wieder: Es war einer der drei Angreifer. Später wurden auch die anderen gefunden.
Als Denis das nächste Mal aufs Revier gerufen wurde, sagte ihm derselbe junge Polizist in informeller Atmosphäre: «Hör zu, die haben sich im Verhör auf eine Verteidigungslinie geeinigt. Sie wollten dich nur auf Drogen kontrollieren, und das Handy sei dir aus der Tasche gefallen. Sie wollten sich vor deinem extremistischen Einfluss schützen, verstehst du?» Für Denis klang das absurd, und der Ermittler erklärte:
«Schau, entweder wir behandeln das weiter als Raub, oder du bekommst Probleme. Denn in unserer Gesetzgebung gibt es keine Formulierungen, mit denen wir dich schützen könnten. Es gibt zwei Varianten: Entweder wurdest du einfach ausgeraubt, oder du fällst unter Terrorismus, Extremismus und all das ‚Gute‘, was 2023 in Bezug auf LGBT beschlossen wurde.»
Daraufhin schlug der Ermittler vor, die Tat als Raub zu qualifizieren und keine Unterlagen einzureichen, in denen die Beleidigungen aus Hassmotiven erwähnt werden. Denis stimmte zu, aus Angst, die drei Angreifer könnten sich noch etwas ausdenken. Aber das Strafverfahren wegen Raubes wurde ebenfalls eingestellt – «mangels Tatbestands», da der Moment des Diebstahls und der Gewalt nicht auf der Videoaufnahme zu sehen war (eine Kopie der Ablehnungsdokumente liegt der Redaktion vor).
«Nach der Version dieser drei wunderbaren Typen sind sie also spazieren gegangen, haben Blumen gepflückt», lacht Denis, «haben mich gesehen, friedlich gefragt, ob ich Drogen habe, wollten mein Handy sehen. Ich habe es ihnen nicht gezeigt, habe es verloren, und alle sind auseinandergegangen. Und die Sache ist erledigt!»
Denis legte keinen Widerspruch ein und forderte keine Wiederaufnahme des Verfahrens. Er fürchtet, dass das Verfahren zu viel Aufmerksamkeit auf ihn und den LGBT-Kontext lenken würde, der im Verlauf der Ermittlungen verloren gegangen war. Dann könnte die «Leitung» ihn nach dem Extremismus-Paragraphen belangen.
Denis hat sich damit abgefunden und berechnet, dass das Geld, das er für einen Anwalt ausgegeben hätte, für ein neues Handy reicht. Er meint, den erlebten Stress relativ leicht verkraftet zu haben, weil er darauf vorbereitet war. Denis erinnert sich, dass er auf dem Weg zur Polizeistation an die Festnahmen von Aktivist*innen bei Protesten gegen die Einstufung von LGBT als extremistische Organisation denken musste – wie sie in Wohnungen eindrangen und Dokumente beschlagnahmten. Als er auf den Stacheldraht am Zaun der Polizeistation sah, dachte er: «Habe ich mehr unter diesen Verrückten von der Straße gelitten, oder werde ich noch mehr von den Strafverfolgungsbehörden leiden, wenn ich dort Anzeige erstatte?»
«Ist es bei uns im Land überhaupt erlaubt, das Geschlecht zu wechseln?»
Leonid, 45 Jahre alt, trans Mann
Im vergangenen Sommer fuhren Leonid und sein Freund aus Kaliningrad zum Schwimmen an den Pelawskoje-See. Am Strand fiel einem fremden, aggressiven, stämmigen Mann die Narbe von Leonids Mastektomie auf. «Normalerweise erkennen nur wenige Leute an den Narben, dass jemand ein trans Mann ist. Aber dieser Mann war in dieser Hinsicht offenbar ziemlich bewandert», wundert sich Leonid. Der Fremde begann aggressiv zu fragen: «Warum sitzt du hier mit Narben? Bist du eine Frau, die sich in einen Mann umwandeln ließ?», und ging dann zu offenen Drohungen über: «Verschwinde aus Russland, ich bring dich um, und mir passiert nichts. Ich habe bei der Wagner-Gruppe gedient, und uns passiert nichts. Wir gelten als Helden Russlands.»
Einen Teil dieses Dialogs konnte Leonid aufnehmen – die Redaktion verfügt über die Tonaufnahme. Dann griff der Wagner-Söldner Leonids Freund an und fragte: «Du bist bestimmt eine Frau, warum trägst du Männerbadehosen?» Das Paar wollte gehen, aber der Mann versperrte ihnen den Weg und verlangte Antworten. Leonid sagte, ihr Aussehen gehe niemanden etwas an. Doch die Worte, dass sie niemanden störten und man sie in Ruhe lassen sollte, hielten den Fremden nicht auf: «Dann erzählte er, wie er mich umbringen würde, dass hier Kinder in der Nähe sitzen, und dass ich mit meinem Körper und den Narben LGBT propagiere. Als ob Kinder das alles verstehen!», wundert sich Leonid.
Um zur Vernunft zu mahnen, wies Leonid darauf hin, dass die Kinder auch die Schimpfwörter und Drohungen des Söldners hören. Der Fremde ließ nicht locker und drohte, Leonid umzubringen, falls er noch einmal im Dorf auftauche. Nach einer weiteren Morddrohung fragte Leonid: «Als du bei Wagner eingetreten bist, bist du da aus dem Gefängnis gekommen, Onkel? Vielleicht saßt du wegen Mordes, deshalb bist du so frech?» Da stoppte der Mann die Drohungen, und das Paar konnte gehen.
Leonid meint, dass man den aggressiven Mann für die Morddrohungen bestrafen könnte – die Beweise auf der Tonaufnahme reichen aus. Aber er hat Angst, zur Polizei zu gehen. Dort hat Leonid bereits zwei Verwarnungen – wegen «LGBT-Propaganda» und «Zeigens von Nazi-Symbolen».
Beide Verwarnungen erhielt er 2022 wegen Äußerungen auf seiner Facebook-Seite: die erste, weil er über sich in männlicher Form schrieb, obwohl seine Dokumente noch den weiblichen Geschlechtseintrag hatten, die zweite, weil er sich gegen den Krieg äußerte.

«Kinder unter 18, die Sie nicht kontrollieren können, könnten Sie als Freunde hinzufügen, machen Sie Ihr Facebook-Profil komplett privat», erinnert sich Leonid an die Worte der Polizistin. Danach wechselte sie abrupt zum Thema der Antikriegs-Kommentare, die Ukrainer unter Leonids Posts hinterließen. Die Polizistin zitierte aus der Anzeige, dass «auf der Seite ukrainische Politik diskutiert wird», und fragte, ob Leonid die Politik von Wladimir Putin gutheiße. «Ich berief mich auf Artikel 51 der Verfassung. Die Polizistin war überrascht, dass ich das wusste. Sie war es offenbar nicht gewohnt, dass Menschen ihre Rechte kennen», erinnert er sich.
Leonid sagte der Polizistin, er werde seine Dokumente auf männlich ändern, um Probleme zu vermeiden. Da war sie erstaunt: «Ist es bei uns im Land überhaupt erlaubt, das Geschlecht zu wechseln?» Damals war das Gesetz zum Verbot der Geschlechtsangleichung noch ein Jahr entfernt – es trat erst am 24. Juli 2023 in Kraft. Letztlich konnte Leonid erfolgreich männliche Dokumente beantragen und sogar verlängern, als er seinen Pass mit 45 Jahren erneuern musste.
Den aggressiven Fremden vom Strand hat Leonid nicht wieder getroffen – er fuhr nicht mehr in die Gegend des Sees. Aber es macht ihm Angst, dass die Drohungen, die er früher nur von transfeindlichen Stalkern im Internet kannte, nun in der realen Welt vorkommen. Leonid und sein Freund sind entschlossen, Russland zu verlassen – sie bereiten jetzt die nötigen Unterlagen für die Ausreise vor.
«Die Straflosigkeit des Täters bestätigt erneut die Hilflosigkeit des Opfers»
Das Gefühl von Ungerechtigkeit stellt das Grundvertrauen in Frage, dass die Welt im Großen und Ganzen gerecht ist und das Gute über das Böse siegt, erklärt die Psychologin Tonja von einer Organisation, die queeren Menschen hilft (Most.Media nennt den Namen der Organisation aus Sicherheitsgründen nicht). Deshalb kann erlebte und ungesühnte Gewalt zu einem Sinnverlust führen, ebenso wie zu Vertrauensproblemen gegenüber Menschen und Institutionen – Polizei, Gerichte –, die eigentlich Gerechtigkeit wiederherstellen sollten, es aber nicht getan haben.

«Allein die Tatsache der Gewalt ist eine Erfahrung von Hilflosigkeit. Die anschließende Straflosigkeit des Täters kann zu erlernter Hilflosigkeit führen – der Überzeugung, dass jede Handlung sinnlos ist, oder zu Schwierigkeiten, die eigenen Grenzen zu verteidigen», erklärt Tonja.
Damit die Schutzmechanismen der Psyche dem Menschen nützen und nicht schaden, schlägt die Psychologin folgenden Handlungsplan für Situationen vor, in denen es nicht möglich ist, Gerechtigkeit wiederherzustellen.
- «Das Erste, was wir tun, ist, uns um unseren Körper zu kümmern, um das Hormonsystem zu beruhigen, wenn die akute Gefahr vorbei ist. Man sollte versuchen, sich auf verschiedene Arten sicher zu fühlen: Das kann Musik sein, Gespräche mit Freunden, Filme, Serien, der Austausch mit künstlicher Intelligenz», schlägt Tonja vor. Wenn sich die Gefahr nicht beseitigen lässt (zum Beispiel wenn ein Jugendlicher weiterhin in die Schule muss, wo er gemobbt wird), kann man die Strategie der «Abschirmung» wählen: den Kontakt mit gefährlichen Personen minimieren und die Zeit in Sicherheit maximieren.
- Der zweite Schritt nach der Minimierung der Gefahr ist, Beweise für die Gewalt zu sichern. Auch wenn es nicht möglich ist, zur Polizei zu gehen, sollte man Verletzungen zumindest für sich selbst fotografieren. In einer akuten Situation empfiehlt Tonja jedoch, sich zuerst um den eigenen psychischen Zustand zu kümmern, auch wenn man dadurch keine Beweise sichern kann.
- Danach empfiehlt Tonja, sich an Freunde, Bekannte oder Selbsthilfegruppen zu wenden. Der Austausch mit Menschen mit ähnlichen Erfahrungen kann helfen, das Schuldgefühl abzubauen. «Manchmal ist es einfacher zu glauben, dass man selbst schuld ist, als zu akzeptieren, dass in der Welt einfach furchtbare und ungerechte Dinge passieren. Die Scham entsteht dann, weil man sich nicht wehren konnte», erklärt sie.
Die Psychologin betont, dass es lange dauern kann, eine Lösung und einen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden. «Aber wenn es einem Menschen gelingt, einen individuellen Rettungsplan zu entwickeln, wird allein der Gedanke an einen Ausweg zur Stütze, um Schwierigkeiten zu überwinden, und hilft, auf dem Weg zur inneren Ruhe nicht zu zerbrechen», sagt Tonja.